Modul 2 - Für Bildungsträger, Programmentwickler:innen & Bildungsdesigner:innen
- Markus Will

- 23. Aug. 2025
- 3 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 24. Aug. 2025

Lernarchitekturen gestalten – KI strategisch integrieren
Wer heute Programme verantwortet, Curricula entwirft oder ganze Weiterbildungsstrategien plant, weiss: KI ist längst kein einzelnes Tool-Thema mehr. Sie verändert das Lernen – und stellt die Frage, wie Bildungsinstitutionen darauf reagieren.
Die Herausforderung liegt nicht darin, ein paar Apps zu kennen. Sondern darin, KI als Querschnittskompetenz systemisch, integral, skalierbar und verantwortungsvoll einzubetten.
Warum das strategische Level zählt
Skalierbarkeit: Einzelne KI-Experimente sind schnell gemacht – aber wie wird daraus ein Programm, das trägt?
Verantwortung: KI in Bildung bedeutet immer auch Ethik & Datenschutz Einhaltung, Biaserkennung, Human in the Loop Sicherstellung und übergeordnete Regelwerke (EU AI Act).
Innovation: Lernarchitekturen brauchen eine Balance zwischen Bewährtem und Neuem. Und mit der Entwicklung gehen.
Orientierung durch das Multi-Hybrid Modell (MHM)
Im Zentrum von Modul 2 steht das Multi-Hybrid Modell. Es bietet eine Landkarte, um KI nicht isoliert, sondern als Teil von Lernarchitekturen zu denken. Folgende vier Hybrid-Beispiele machen deutlich, wie das gelingt:
Hybrid 1: Mensch & Maschine verzahnen
Leitfragen: Wann übernimmt die KI? Wann übernimmst du? Wie entstehen Entscheide – und auf welcher Grundlage?
Praxisbeispiel: KI generiert erste Lernziel-Vorschläge → Lehrperson prüft nach Taxonomiestufen & Zielgruppenbezug → KI liefert Alternativen → Lehrperson trifft die Entscheidung.
Wirkung: Rollenklärung, Entscheidungsfähigkeit, Verbindung von Fach- und Medienkompetenz, Autonomie in der Steuerung.
Hybrid 2: Analog & Digital verbinden
Leitfragen: Wie gelingt Wechselspiel statt „Entweder-oder“? Wann braucht Lernen echte menschliche Präsenz?
Praxisbeispiel: Dreifache Reflexion zu „Lernen mit KI“ → Selbstreflexion analog, Ergänzungen durch KI, anschliessende Diskussion im Plenum.
Wirkung: Stärkung der Präsenzqualität, bewusstes Zusammenspiel analog/digital, Flexibilität im Methodeneinsatz, Transfer durch Miteinander.
Hybrid 3: Individuell & kollektiv balancieren
Leitfragen: Wie wird persönliches Lernen mit gemeinsamen Prozessen verbunden?
Praxisbeispiel: Lernende skizzieren analog individuelle Lektionen und ergänzen sie mit KI → Reflexion im Plenum → Justierung der eigenen Version.
Wirkung: Selbstverantwortung, soziale Integration, Feedbackkompetenz, nachhaltiger Transfer.
Hybrid 4: KI-gestütztes Selbstlernen mit Chatbot
Leitfragen: Wie kann KI ausserhalb der Präsenzzeit Lernwege begleiten – ohne didaktische Beliebigkeit?
Praxisbeispiel: Individueller Lernpartner-Chatbot für Vor- und Nachbereitung von Lektionen, mit wählbaren Formaten (individualisierte Übungsfragen oder Quizzes etc.) → Reflexion, was übernommen oder verworfen wurde → Sicherung durch menschliche Steuerung.
Wirkung: Förderung individueller Lernwege, Vertiefung & Transfer, KI-Kompetenz im Alltag, Nachhaltigkeit über die Präsenzzeit hinaus – für lebenslanges Lernen.
Gefahr der Kompetenzerosion entgegnen
Warum ist dieses Modell so wichtig? Weil KI – wenn sie unreflektiert eingesetzt wird – dazu führen kann, dass Lernende eigene Kompetenzen abbauen oder gar nicht erst aufbauen:
Wer nur auf KI-Antworten setzt, trainiert weniger das eigene kritische Denken.
Wer Ergebnisse übernimmt, statt sie zu prüfen, verliert Bewertungs- und Transferfähigkeit.
Wer Lernprozesse abkürzt, läuft Gefahr, oberflächliches Wissen statt tragfähiger Kompetenzen aufzubauen.
Das MHM wirkt hier wie ein Gegengewicht. Indem es Lernarchitekturen hybrid denkt, sorgt es dafür, dass KI immer im Zusammenspiel mit menschlichen Fähigkeiten steht – nicht an deren Stelle. So bleibt die Rolle der Lernenden aktiv, kritisch und gestaltend.
Fazit
Die Frage ist nicht mehr, ob KI in die Erwachsenenbildung gehört.Die Frage ist: 👉 Wie gestalten wir Lernarchitekturen, die Didaktik, Verantwortung und Innovation verbinden – ohne Kompetenzen zu verlieren?
Genau hier setzt unser Modul 2 an – als strategischer Rahmen und praktischer Werkzeugkasten für alle, die Bildungsprogramme fit fürs KI-Zeitalter machen wollen.
Und noch etwas wird deutlich: Wenn KI in einer verantwortungsvollen, unterstützenden Rolle eingesetzt wird, ist sie nicht „Störfaktor“ oder „Ersatz“. Sie ist das vierte Eck im didaktischen Viereck:
Lehrende ↔ Lernende ↔ Lerninhalte – ergänzt durch KI als Lernpartner.
KI unterstützt, liefert Optionen und Feedback.
Die pädagogische Entscheidung bleibt beim Menschen.
So wird aus dem klassischen Dreieck ein stabiles Viereck – mit KI als Assistenz- und Sparring-Ecke, die Lernprozesse stärkt, statt Kompetenzen abzubauen.
👉 Infos & Anmeldung:
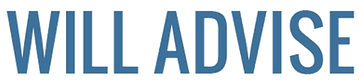



Kommentare